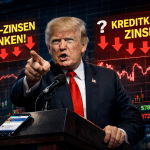Der US-Aktienmarkt wird getragen vom Megatrend Künstliche Intelligenz (KI). Die Parallelen zur Dotcom-Ära: Euphorie, Momentum und eine enorme Konzentration. Doch das ist das ganze Bild. Bewertungen, Gewinne und Indexstruktur zeigen, wo sich die Geschichte wiederholt – und wo nicht. Sieben Thesen zur Frage: KI-Boom oder Tech-Blase?
1. Bewertung und Struktur: heiß wie 1999
Der S&P 500 notiert derzeit bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) von rund 27,9, das zyklisch bereinigte Shiller-KGV (CAPE) liegt bei etwa 39 – nur während der Dotcom-Blase war es höher (damals über 44). Damit befindet sich der Markt auf dem zweithöchsten Bewertungsniveau der modernen Geschichte.
Im Technologiesektor, wo die KI-Euphorie am stärksten wirkt, liegt das Trailing-P/E bei etwa 39,5, das Forward-P/E bei rund 30 laut S&P Global. Zum Vergleich: Der historische Durchschnitt des Gesamtmarkts liegt bei etwa 16 bis 17. Der Markt ist also nicht im Crashmodus, aber eindeutig überdehnt.
Noch extremer ist die Bewertung bei den Magnificent 7: Hier liegt das durchschnittliche Forward-KGV bei rund 33. Damit bezahlen Anleger für die Wachstumserwartung der Tech-Giganten fast die doppelte Bewertung wie für den Rest der US-Wirtschaft.
2. Die neue Macht der „Magnificent Seven“
Sie heißen Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla – und sie bestimmen, wie sich der weltweite Aktienmarkt bewegt. Gemeinsam vereinen die Maginficent 7 rund 34 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 (Quelle). Noch nie zuvor hing der Index so stark von einer kleinen Gruppe ab. Und weil der kapitalisierungsgewichtete MSCI World zu gut 70 Prozent aus US-Aktien besteht, gilt die Abhängigkeit auch für klassische Aktien-Welt-Portfolios.
Die Dominanz der großen Sieben ist keine Luftnummer: sie erwirtschaften inzwischen etwa ein Viertel aller Gewinne im S&P 500. Wie Reuters berichtet, stiegen ihre kumulierten Gewinne 2024 um rund 37 Prozent, während der Rest des Marktes nur um 7 Prozent zulegte. Für 2025 zeigen Konsensprognosen von Bloomberg Intelligence ein erwartetes Gewinnwachstum von rund 15 Prozent für die Magnificent Seven – gegenüber 5 bis 6 Prozent beim S&P 493. Wie wir weiter oben gesehen haben, spiegeln auch die Bewertungen diese Dominanz wider.
Diese Diskrepanz erklärt, warum Indizes und globale Benchmarks so sensibel auf jede Nachricht aus dem KI-Sektor reagieren – die Kursentwicklung von sieben Unternehmen entscheidet heute faktisch über die Stimmung an den Weltbörsen.
3. KI-Boom vs. Tech-Bubble: Die Unterschiede
Damit werden die Parallelen zu 1999 offensichtlich: Ein technologischer Umbruch elektrisiert die Märkte, Bewertungen steigen, Investoren fürchten, etwas zu verpassen. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Im Gegensatz zur Dot-Com-Bubble ist die fundamentale Basis der Unternehmen heute viel solider.
Profitabilität: Die großen Tech-Unternehmen sind hochprofitabel und erzielen operative Margen zwischen 25 und 40 Prozent – ein Niveau, das es in der Dotcom-Ära kaum gab. Damals lebten viele Unternehmen von Erwartungen statt von Einnahmen.
Geschäftsmodelle: Sowohl das Internet damals als auch KI heute markieren echte technologische Revolutionen. Der Unterschied liegt in der wirtschaftlichen Reife: Während viele Internetunternehmen um die Jahrtausendwende noch kein tragfähiges Geschäftsmodell hatten, fließt KI heute direkt in bestehende, profitable Strukturen ein – etwa in Cloud-Dienste, Werbung oder Prozessautomatisierung. Die Monetarisierung ist also nicht hypothetisch, sondern bereits sichtbar – auch wenn sie sich über Jahre entfalten wird.
Kapitalstruktur: Die heutigen Tech-Giganten sind solide finanziert und investieren aus eigener Kraft. Zur Jahrtausendwende lebten viele Start-ups von Venture-Kapital – das versiegte, als die Kurse fielen.
Infrastruktur: KI baut auf bestehender digitaler Infrastruktur auf – Server, Chips, Datenplattformen. Das Internet musste damals erst geschaffen werden.
4. KI-Wirtschaft: ein geschlossenes Öko-System?
In den vergangenen Wochen machen Analysten und skeptische Investoren auf ein neues Merkmal des KI-Bullenmarkts aufmerksam: Es ist der zirkuläre Kapitalfluss, den Morgan Stanley in seiner „Circular Relationships“-Analyse beschreibt. Unter den Marktführern der KI-Branche hat sich ein immer dichteres Netzwerk gegenseitiger Beteiligungen, Kapitalflüsse und Geschäftsbeziehungen gebildet – im Mittelpunkt steht der AI-Pioneer OpenAI, der in kurzer Abfolge strategische Partnerschaften mit Nvidia, AMD, Broadcom, Oracle und CoreWeave geschlossen hat. Das vollzieht sich auch auf kleinerem Maßstab: Große Technologieunternehmen beteiligen sich an KI-Start-ups, die wiederum Cloud-Kapazitäten, Chips oder Software derselben Konzerne einkaufen.
So entsteht ein Selbstverstärkungseffekt, der kurzfristig Umsatzwachstum erzeugt, zugleich aber Abhängigkeiten und systemische Risiken schafft. Die Verflechtungen verstärken profitable Beziehungen, können jedoch Risiken kaschieren und zu konzertierten Übertreibungen bei der Nachfrage führen. Da zentrale Umsätze und Investitionen teilweise zirkulieren und doppelt verbucht werden, könnten Anleger das tatsächliche Ausmaß des Wachstums überschätzen.
Nvidia profitiert hier doppelt: Der Chipkonzern liefert Hardware an nahezu alle großen KI-Anbieter und ist zugleich an mehreren dieser Unternehmen beteiligt. Solche Rückkopplungssysteme können die Dynamik verlängern – oder, im Fall enttäuschter Erwartungen, zu gleichzeitigen Korrekturen führen.
5. Gefährliche Liebschaft? Alle haben diese Aktien
Die Dominanz der US-Tech-Riesen betrifft längst nicht nur amerikanische Anleger. In den globalen Leitindizes MSCI World und MSCI ACWI machen die Magnificent 7 mehr als 25 Prozent der Marktkapitalisierung aus. Bereits ein Blick auf die größten Publikumsfonds in Europa zeigt die Dominanz von US-Tech-Aktien in europäischen Portfolios. Der iShares Core S&P 500 ist Europas größter Fonds mit einem Vermögen von 110,5 Milliarden Euro, gefolgt vom iShares Core MSCI World ETF mit 101,7 Millarden Euro. Drei weitere ETFs auf den S&P 500 befinden sich in Europa unter den Top zehn Fonds mit Vermögenswerten zwischen 27 Milliarden und 64 Milliarden Euro. Insgesamt verwenden europaweit Fonds und ETFs mit einem Vermögen von über eine Billion Euro den MSCI World als Benchmark, rund 600 Milliarden Euro befinden sich in Fonds und ETFs mit Benchmark S&P 500.
Damit hängt ein erheblicher Teil der weltweiten Aktienrendite an denselben Namen – und neben Fonds und ETFs gibt es ja noch Pensionsvermögen und Vermögensverwaltungsmandate außerhalb der Fondswelt – von Einzelengagements in den US-Tech-Aktien ganz zu schweigen. Die Konzentration der globalen Portfolios ist so hoch wie nie zuvor, und sie verleiht der Kursentwicklung von KI-Schwergewichten eine systemische Bedeutung.
6. Wie solide sind die KI-Unternehmensgewinne?
Kurzfristig belasten KI-Investitionen die Margen, weil der Aufbau von Rechenzentren, Datenarchitekturen und Modellen enorme Summen verschlingt. Langfristig aber dürfte der Produktivitätshebel erheblich sein. Nach Schätzungen von Goldman Sachs und McKinsey könnte KI bis 2030 den aggregierten Gewinn der im MSCI World gelisteten Unternehmen um rund 15 Prozent steigern.
Das ist der fundamentale Unterschied zur Internet-Ära: Damals musste erst bewiesen werden, dass die Technologie überhaupt Geld verdienen kann. Heute ist klar, dass KI in bestehenden Geschäftsmodellen realen Mehrwert schafft – nur das Tempo der Monetarisierung bleibt unsicher.
7. Schritte gegen die Marktkonzentration
Die Bewertungen sind hoch, die Euphorie greifbar, und die Parallelen zur Jahrtausendwende sind nicht zu übersehen. Doch anders als im Jahr 2000 stehen hinter dem heutigen Tech-Boom profitable, kapitalstarke Unternehmen mit realem Cashflow. Die hohe Konzentration auf wenige Wachstumswerte und die extreme Bewertung einzelner KI-Giganten erzeugen Verwundbarkeit, doch sie beruhen auf echten Gewinnen und strukturellem Wandel, nicht auf bloßen Versprechen. Einerseits.
Andererseits wird die Luft aktuell immer dünner an den Märkten. Das Forward-KGV des S&P 500 liegt aktuell bei etwa 20, gegenüber einem 20-Jahres-Durchschnitt von rund 16 laut FactSet. Das Shiller-KGV bewegt sich mit 39 auf dem zweithöchsten Stand seit 1870. Innerhalb dieses ohnehin hohen Bewertungsniveaus handeln die Magnificent Seven im Schnitt rund 70 Prozent über dem Rest des Index – ein Niveau, das auf Dauer kaum haltbar ist.
Eine sektorale Korrektur im Technologiekomplex von 15 bis 25 Prozent wäre daher keine Katastrophe, sondern eine notwendige Normalisierung nach Jahren überhöhter Erwartungen. Entscheidend ist, wie die erfolgsverwöhnten Anleger, von denen viele noch nie eine nachhaltige Korrektur erlebt haben, auf scharfe Kursverluste reagieren würden.
Wer Klumpenrisiken in den großen Tech-Titeln reduziert, Teile seines Portfolios wieder stärker in Sektoren außerhalb der Tech-Branche investiert oder stärker auf die Sicherheit festverzinslicher Anlagen baut, diversifiziert sein Portfolio und stärkt seine Stabilität für den nächsten Zyklus. Gerade in einem Umfeld extremer Konzentration entscheidet die richtige Portfolioarchitektur über langfristigen Erfolg – und genau hier setzt die Expertise von envestor an.
Die envestor-Expertise für Sie: Jetzt Info-Termin buchen
Sie sind neugierig geworden, wie wir bei envestor Anlegerportfolios konstruieren und wetterfest machen? Sie möchten sich über unsere Dienstleistungen informieren? Hier können Sie ein unverbindliches Gespräch vereinbaren. Mehr über den envestor Cashback, der investieren günstiger macht, als es Ihre Bank erlaubt, erfahren Sie hier.
Autor
-

Steffen Gruschka ist CFO und Co-Geschäftsführer von envestor und blickt auf rund 30 Jahre Erfahrung im aktiven Management von Schwellenländer-Aktienfonds zurück. In seiner Laufbahn wurde er mehrfach als Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet. Zuletzt erreichte er 2025 in der Kategorie Aktien Emerging Markets die Spitzenposition und gehörte damit laut Handelsblatt zu den besten Fondsmanagern Deutschlands.
Alle Beiträge ansehen